| Menü > | Eisenbahn > | Romantik | zurück | |||||||||
|
Wenn ich heute mit der Bundesbahn fahre und neben dem Fahrgleis die hellgelb gestrichenen motorisierten Gleisbau- und Gleisunterhaltungsmaschinen sehe, dann gehen meine Gedanken unwillkürlich 70 Jahre zurück, in eine Zeit, in der ich als jugendlicher Arbeiter von 16 Jahren einmal kurze Zeit in der Bahnunterhaltung tätig war. Es war am Ende der 80er Jahre (1880) auf der als Privatbahn von der Firma H. Bachstein erbauten und betriebenen Strecke von Küstrin nach Stargard in Pommern. Diese Bahn wurde im Jahr 1903 vom Preußischen Staat übernommen und in das Netz der preußisch-hessischen Staatsbahnen eingegliedert. Die Bahnmeisterei Neudamm hatte den Streckenabschnitt von Küstrin bis Ringenwalde (Neumark) zu unterhalten. Ihr standen dazu zwei Kolonnen von je 12 Arbeitern zur Verfügung. Meistens waren es ältere Leute, die schon jahrelang bei der Eisenbahn arbeiteten. Daß dazwischen einmal so ein junger Dachs auftauchte wie ich, war eine Ausnahme. Zur planmäßigen Überarbeitung der Strecke wurden die Kolonnen verstärkt. In den Zeiten, in denen keine Feldbestellungen und Erntearbeiten wahrzunehmen waren, kamen jüngere Landleute als Saisonarbeiter zu uns. Die Führer der Kolonnen hießen damals noch "Vorarbeiter", trotzdem sie Beamte waren. Bald erhielten sie aber den Titel "Rottenführer". Einer, der schon über 60 Jahre alte Vater Höwing, trank oft und gern ein Schnäpschen. Davon und von dem dauernden Aufenthalt im Freien war seine Gesichtshaut rot und ledern wie die eines Indianers. Zu ihren Arbeitsstellen begaben sich die Kolonnen mit einem "Kleinwagen", einem 4-rädigem Plattformwagen mit Geländer. Die Räder hatten an den Außenseiten herausragende kurze Bolzen. Auf diese wurden von der Plattform aus etwa 2,50 m lange Stäbe gesteckt, die am unteren Ende quer etwas ausgehöhlt waren. Je 2 Mann drückten mit diesen Stäben die immer wieder hochkommenden Bolzen an den Rädern nach unten und bewegten dadurch das Fahrzeug vorwärts. Geschwindigkeiten wie die heutigen FD-Züge konnten wir dabei nicht erzielen, aber wir kamen hin, wo wir hinwollten. Bei Beginn der Arbeiten wurde ein nach den Zugpausen bemessener Gleisabschnitt "ausgekoffert", d. h. der zwischen und unter den Schwellen liegende Kies, die "Bettung" wurde herausgeschaufelt und wenn nötig gesiebt. Dann wurden alle Schrauben nachgezogen und lose Schienennägel festgeschlagen, wobei dauernd auf die Einhaltung der Spurweite geachtet werden musste. Dann wurde der Kies wieder eingeschaufelt und die "Stopfkolonnen" traten in Aktion. Je 4 Mann mit besonders geformten Stopfhacken klopften im Viertakt den Kies beiderseitig unter den Schwellen fest. Einer zählte die Schläge und rief dann "Fuffzehn", darauf wurde eine kleine Verschnaufpause gemacht. Die Höhenlage des Gleises bestimmte damals noch der Rottenführer nach Augenmaß. Er ließ in Abständen von ungefähr 50 m Pfähle mit einer aufgemachten Querlatte einschlagen, die er sich wie über Visier und Korn auf eine Gerade ausrichtete. Dann hob er das Gleis an diesen Pfählen bis zu einer daran angebrachten Markierung an und ließ es feststopfen. Dann ging er in die Knie oder legte sich auf den Bauch und sah an der Außenkante der Schiene entlang. Er ließ alle Unebenheiten beseitigen, bis die Kanten eine schnurgerade Linie war. Die gegenüberliegende wurde mit der in das Spurmaß eingelassenen Wasserwaage in die richtige Lage gebracht. Zur Korrektur der Seitenrichtung traten 4 Mann mit Richtbäumen in Aktion, die sie unter die Schienenstange steckten und auf Kommando das Gleis auf Anweisung des Rottenführers nach rechts oder links drückten, bis eine schnurgerade Richtung erreicht war. Zum Schluß kam ein Mann mit einem Rechen, in dem 2 Schienennägel eingeschlagen waren, so dass er ihn ohne seitlich abzurutschen auf dem Schienenstrang entlangziehen konnte. Etwa 50 cm seitlich saß ein weiterer Schienennagel, der auf der seitlichen Aufschüttung der Bettung, dem "Bankett", einen Strich zog. So war es möglich, diese Banketts mit einer schnurgeraden Kante aufzuschaufeln. Das so überarbeitete Gleis sah dann recht sauber und ordentlich aus. Bei alledem roch es aber doch reichlich nach Arbeit. Wir standen ja immer unter Druck, weil der in Arbeit genommene Streckenabschnitt bis zur Durchfahrt des nächsten Zuges fertig sein musste. Ganz anders und manchmal geradezu romantisch ging es bei den sogenannten "Fliegenden Kolonnen" zu. Bei starkem Regen drang Wasser seitlich an den Schwellen in die Bettung ein. Einzelne fingen bei der Überfahrt der Züge an zu "suppen" und verloren ihre durch das Unterstopfen der Bettung erreichte Festlage. Die aufgenagelte Schiene erfuhr an einer solchen Stelle eine Senkung, es entstand ein "Schlag". Diese Schläge, die ein seitliches Ausschlagen der Wagen verursachten, mussten schleunigst beseitigt werden. Dazu waren die fliegenden Kolonnen unterwegs. Sie waren, je nach Arbeitsanfall, 6-8 Mann stark. Die Schäden meldete der "Streckenläufer", ein Bahnwärter, der täglich einmal die Strecke begehen musste. Auch die Lokführer meldeten schadhafte Stellen, die sie ja durch seitliches Ausschlagen der Lok merkten. Morgens um 6:00 Uhr zogen also die fliegenden Kolonnen hinaus auf die Strecke. Wenn sie keinen Kleinwagen zur Verfügung hatten, gingen sie zu Fuß und trugen ihr Werkzeug selbst. Bei einem Schlag, also einer Senke im Gleis angekommen, trat dann zunächst ein Mann mit dem "Hund" in Aktion. Der Hund war ein abgeschnittenes Schwellenende von 25-30 cm Länge, in das ein Schienennagel als Handgriff eingeschlagen war. Er schaufelte außen an der Schlagstelle ein kleines Loch und warf den Hund hinein. Dann kamen 2 Arbeiter mit dem eisenbeschuhten und mit Handgriffen versehenen "Hebebaum", den sie über den Hund hinweg unter den Schienenstrang steckten. Nach Zuruf des an der Außenkante des Schienenkopfes entlangsehenden Rottenführers brachten sie durch Drücken auf den Hebebaum das Gleis wieder in die richtige Lage. Zwei Arbeiter mit Stopfhacken stopften es fest. Kleine seitliche Verschiebungen wurden mit Richtbäumen begradigt, das Hundeloch wurde zugekratzt und dann ging es weiter. Diese Arbeiten drängten nicht so und konnten im gemütlichen Tempo erledigt werden. In schöner Landschaft und bei gutem Wetter machten sie direkt Spaß. Das schönste aber waren die Pausen. Unsere Dienstschicht betrug ja 12 Stunden, von 6:00 Uhr morgens bis 6:00 Uhr abends. Die 24-Stundenrechnung hatten wir damals noch nicht. In der Schicht lagen eine halbe Stunde Frühstückspause, eine Stunde Mittags und eine halbe Stunde Vesperpause. Häufig wurde in den Pausen ein kleines Feuerchen gemacht, um mitgebrachte Speisen und Getränke anzuwärmen. Im Herbst ging auch mal einer auf ein Kartoffelfeld, um einige Pfund neue Kartoffeln auszugraben, die dann im offenen Feuer geröstet wurden. Schön durchgebraten und so lecker aufgeplatzt schmeckten sie vorzüglich. Wenn ein Dorf in der Nähe war, hatte auch schon jemand eine Mandel Salzheringe geholt und dann wurde direkt geschlemmt. Aber diese Mahlzeiten zogen etwas nach sich, es gab Durst. Nun hatten wir ja eine hölzerne, einhenkelige Wasserkanne von etwa 5 Liter Inhalt mit, aber vom vielen Wasser wurde einem so naß im Magen. So wurde nachgeschaut, ob vom Taschengeld noch einige Groschen abgezweigt werden konnten. Wenn dabei 1,60 RM zusammengekommen waren, ging ein Mann mit der leeren Wasserkanne ins Dorf und ließ im Gasthof 1 Liter Sprit für 1,50 RM und für 10 Pfennige Himbeersaft einfüllen. An der letzten Pumpe, die er auf dem Rückweg passierte, füllte er bis zu einem an der Kanne angebrachten Eichstrich Wasser nach. Das war dann die richtige Mischung, und nach seiner Rückkehr zur Kolonne machte die Kanne gleich mehrmals die Runde. Natürlich durfte der Rottenführer anfangen. Zecher, die gern einen großen Schluck tranken, konnten sich aus der großen hölzernen Kanne unauffällig bedienen. Nachher ging dann in etwas beschwingter Stimmung die Arbeit umso besser voran. Schlecht war es bei Regenwetter. Wenn es schon morgens regnete, gingen wir gar nicht erst hinaus, sondern blieben im Gerätekeller und besserten Geräte aus, machten Holznägel zum Ausfüllen ausgeleierter Schienennagellöcher usw. Waren wir schon draußen und es war kein Ende des Schlechtwetters abzusehen, gingen oder fuhren wir wieder heim. War ein Aufhören des Regens abzusehen, suchten wir Unterkunft in Scheunen und Ställen in Gleisnähe liegender Gehöfte. Einige hatten immer ein Kartenspiel in der Tasche und bald waren lustige Spielchen im Gange. Skat war damals noch nicht so verbreitet, wir spielten "Schafskopf", "Siebzehn und vier" und "Sechsundsechzig". Manchmal hörte der Regen viel zu früh auf, aber dann ging es doch wieder an die Arbeit. Ja, das waren noch andere Zeiten. Wir waren mit unseren Arbeiten persönlich mehr verbunden als unsere heutigen Kollegen im Maschinenzeitalter. Die Frage, ob die damaligen Zeiten allgemein besser waren als die heutigen, kann man wohl mit "Ja" und "Nein" beantworten.
|
||||||||||||
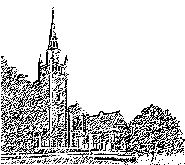 |
||||||||||||


